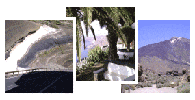die Wüstenwinde und ihre Namen Die sandige Windfrachthat hat ein großes Potenzial und beschränkt sich keinesfalls auf die Kanaren. Denn sie entsteht durch einen mächtigen Sog, der sich bildet, wenn ein Hoch über der Sahara die Temperaturen ansteigen und die Luftfeuchtigkeit rapide sinken lässt. Bis zu 5.000 Meter hoch werden dann sogenannte Aerosole in die Atmosphäre gezogen, wo sie je nach Ausgangspunkt und Windrichtung weiter driften. Der Scirocco treibt sie nach Europa, der Chamsin weht sie nach Südosteuropa und Vorderasien, und der Passat schickt die Partikel auf die Kap Verden, auf die Kanaren und teils tausende Kilometer weiter über den Atlantik bis nach Südamerika, weiter nördlich in die Karibik und manchmal sogar bis Nordostamerika. Wie sich diese Sandfahnen aufs Weltklima auswirken, ist inzwischen Thema für viele Wissenschaftler geworden, insbesondere weil sich die Staubmenge in der Luft im 20. Jahrhundert stark erhöht hat.
Sahara-Sand: Vom Winde verweht düngt er den Atlantik...
Sandsturm in der Sahara: Die Staubkörnchen aus Afrika sind nährstoffreich und entpuppen sich beim Herabrieseln in den Atlantik als Dünger für Phytoplankton.
Klimaforscher und Meeresbiologen untersuchen seit mehr als zehn Jahren, was mit den Sahara-Partikeln auf ihrer Reisund ihrem sukzessiven "Fallout" in Richtung Westen über dem Atlantik geschieht - unter anderem mit Hilfe von Bojen, an denen sogenannte Sinkstoff-Fallen hängen. Daran sammeln sich die nach und nach - entsprechend ihrer Schwere - ins Meer rieselnden Wüstenteilchen an. Damit einhergehende Analysen mit dem Rasterelektronenmikroskop ergeben exakten Aufschluss über die chemische und mineralogische Zusammensetzung der Schwebstoffe und damit über ihre Herkunft. Im Verlauf dieser Studien stellte sich heraus, dass die afrikanischen Staubkörchen unter vielem anderen Stickstoff, Phosphor und Eisen transportieren. Grund: Die Zentralsahara war in prähistorischer Zeit ein See, und nach dessen Austrocknung besteht der Sand zum großen Teil aus den fruchtbaren Überresten seiner einst organischen Bewohner. Fazit: Insbesondere die stickstoffreichen Calima-Bestandteile "düngen" den Atlantik, indem sie das Wachstum von Phytoplankton fördern. Dies hat zwei Vorteile: Zum einen bildet Phytoplankton die Basis der Nahrungskette in den Ozeanen und fördert somit den Bestand aller möglichen Meeresbewohner. Zum anderen hoffen Klimaforscher, dass so der Treibhauseffekt minimiert wird. Denn die Mikroorganismen im Meer nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf – soll heißen: Je mehr Phytoplankton im Wasser, desto weniger CO2 in der Luft. Allerdings birgt zuviel Staubeintrag in den Atlantik potenziell auch Nachteile: unkontrolliertes Planktonwachstum und sauerstoffarme Bereiche...
https://www.la-palma24.info/calima-und-kanaren/
Sahara-Sand: Vom Winde verweht düngt er den Atlantik...
Sandsturm in der Sahara: Die Staubkörnchen aus Afrika sind nährstoffreich und entpuppen sich beim Herabrieseln in den Atlantik als Dünger für Phytoplankton.
Klimaforscher und Meeresbiologen untersuchen seit mehr als zehn Jahren, was mit den Sahara-Partikeln auf ihrer Reisund ihrem sukzessiven "Fallout" in Richtung Westen über dem Atlantik geschieht - unter anderem mit Hilfe von Bojen, an denen sogenannte Sinkstoff-Fallen hängen. Daran sammeln sich die nach und nach - entsprechend ihrer Schwere - ins Meer rieselnden Wüstenteilchen an. Damit einhergehende Analysen mit dem Rasterelektronenmikroskop ergeben exakten Aufschluss über die chemische und mineralogische Zusammensetzung der Schwebstoffe und damit über ihre Herkunft. Im Verlauf dieser Studien stellte sich heraus, dass die afrikanischen Staubkörchen unter vielem anderen Stickstoff, Phosphor und Eisen transportieren. Grund: Die Zentralsahara war in prähistorischer Zeit ein See, und nach dessen Austrocknung besteht der Sand zum großen Teil aus den fruchtbaren Überresten seiner einst organischen Bewohner. Fazit: Insbesondere die stickstoffreichen Calima-Bestandteile "düngen" den Atlantik, indem sie das Wachstum von Phytoplankton fördern. Dies hat zwei Vorteile: Zum einen bildet Phytoplankton die Basis der Nahrungskette in den Ozeanen und fördert somit den Bestand aller möglichen Meeresbewohner. Zum anderen hoffen Klimaforscher, dass so der Treibhauseffekt minimiert wird. Denn die Mikroorganismen im Meer nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf – soll heißen: Je mehr Phytoplankton im Wasser, desto weniger CO2 in der Luft. Allerdings birgt zuviel Staubeintrag in den Atlantik potenziell auch Nachteile: unkontrolliertes Planktonwachstum und sauerstoffarme Bereiche...
https://www.la-palma24.info/calima-und-kanaren/